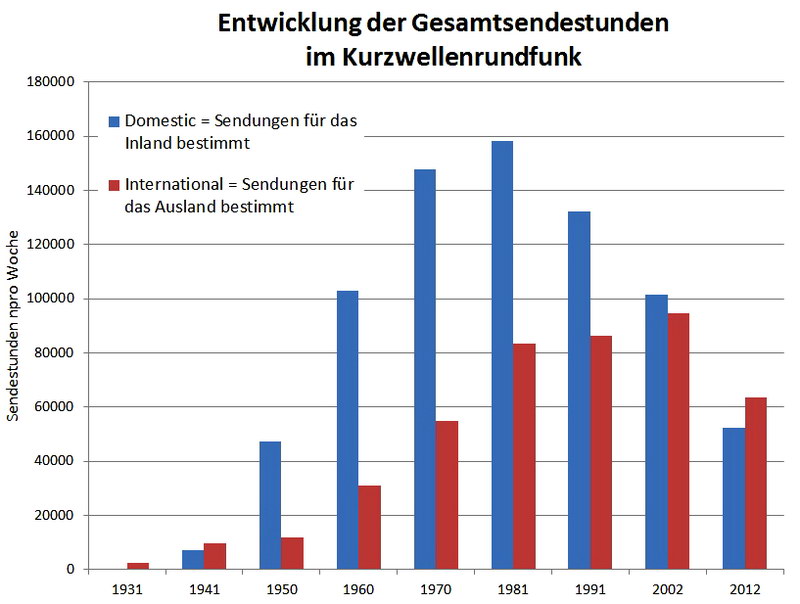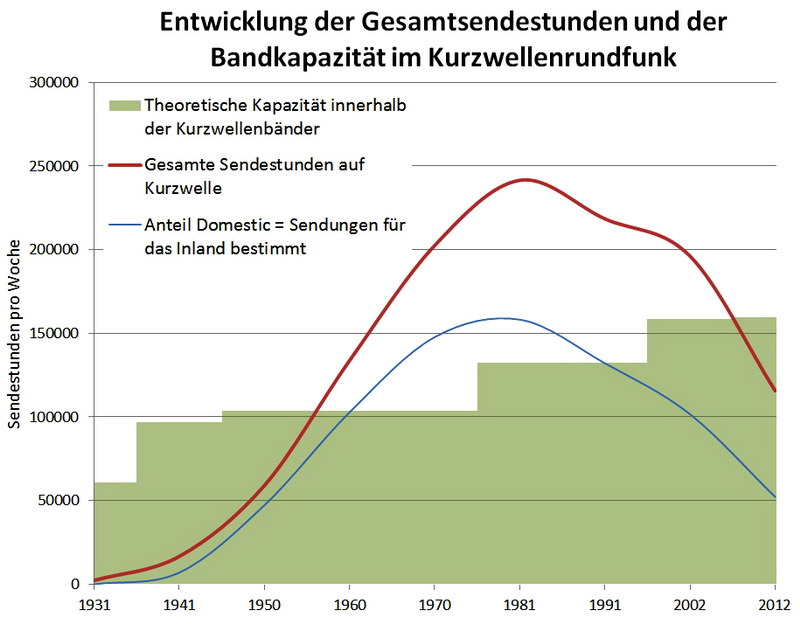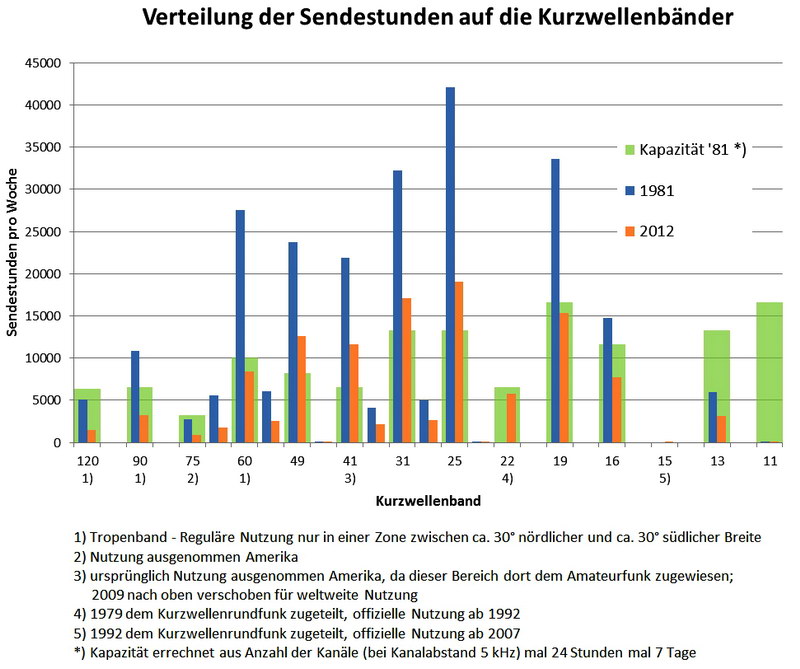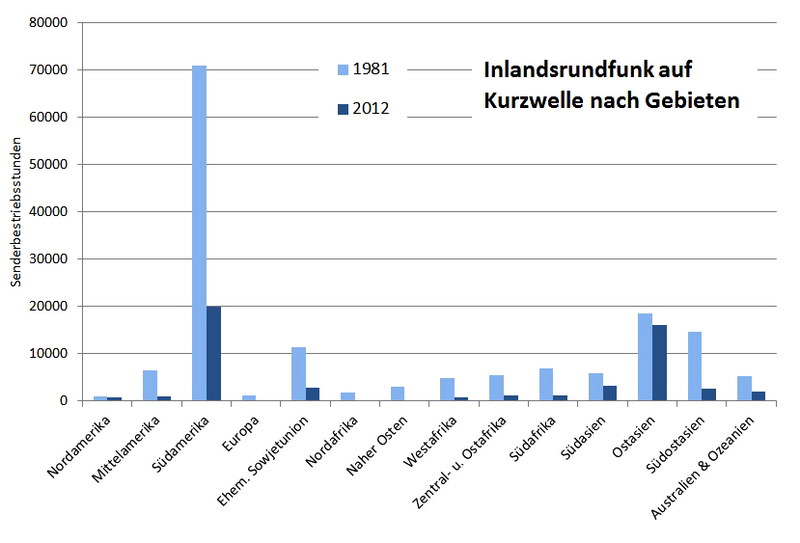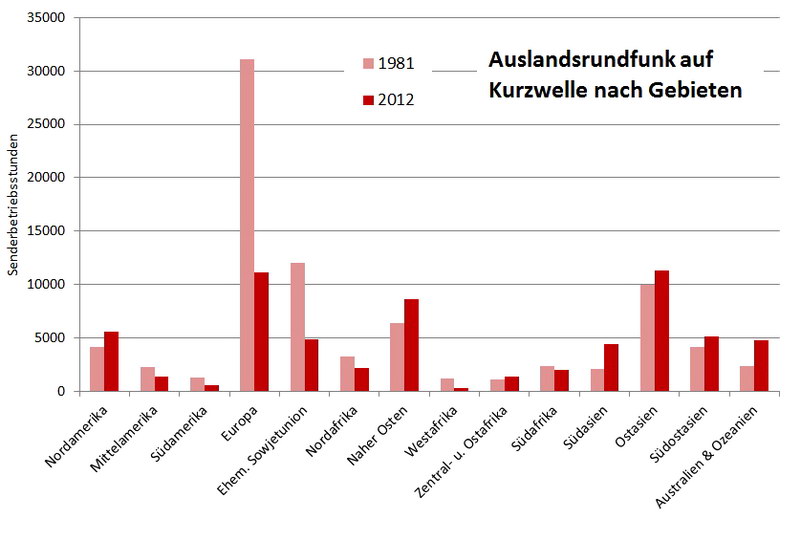| Statistische
Betrachtung der Entwicklung des Kurzwellenrundfunks |

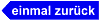 |
|
| Der Kurzwellenrundfunk erfuhr erst durch den 2.
Weltkrieg und den nachfolgenden Ost-West-Konflikt eine starke
Aufwertung. Mit keinem anderen Medium konnte man zu jener Zeit derart
tief in "Feindesland" eindringen. Den Höhepunkt der Bedeutung erreichte der
Kurzwellenrundfunk in den 1970er-Jahren, als die zunehmende
internationale wirtschaftliche Verflechtung der Welt ein verstärktes
Interesse an Geschehnissen in fremden Ländern entstehen ließ; und die
Kurzwelle war (noch) die einzige technische Möglichkeit, authentische
Informationen in Istzeit zu übertragen. Dies hat sich heute grundlegend
geändert. Internet und Satelliten-TV bieten vielfältigere Informationen und
sind technisch zuverlässiger. In der Folge ist der Kurzwellenrundfunk
auf dem Rückzug - vielleicht zu jenen Wurzeln in den 1920er-Jahren, als
die Kurzwelle für spezielle Zwecke ohne Massenwirkung eingesetzt wurde. |
|
|
Dazu:
Der Beginn des Kurzwellenrundfunks |
|
Nachfolgend einige Diagramme zur Veranschaulichung,
wie sich der Kurzwellenrundfunk seit den Anfängen vor ca. 90 Jahren entwickelte.
Die Basis der Untersuchung bildeten die Summen der Sendestunden, also jene
Zeiten, in denen ein Signal auf einer Frequenz gesendet wurde. Berücksichtigt
wurden nur offizielle Sendungen, also nicht jene, die zur Störung von Sendungen
aus dem Ausland dienten. Als Datenquellen diente (ab 1950) das "World Radio TV
Handbook", für den Zeitraum vor 1950 in Zeitschriften veröffentlichte
Sendepläne. Da der Kurzwellenrundfunk zwei sehr
unterschiedliche Zielsetzungen verfolgte, wird auch in den Diagrammen zwischen
den beiden Kategorien unterschieden:
1) Domestic: Sendungen, welche vornehmlich zur Versorgung großflächiger
Staaten bzw. deren Umfeld (Nachbarländer) dienten.
2) International: Sendungen, die speziell für das Ausland bestimmt waren;
entweder in Fremdsprachen oder in der/den Landessprache(n) zur Information von
im Ausland befindlichen Bürgern. |
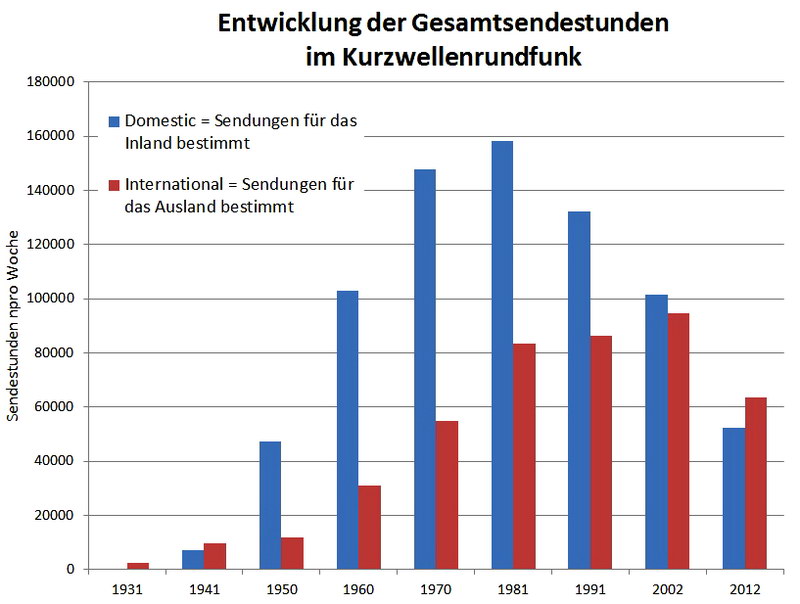 |
|
Rundfunksendungen auf Kurzwelle hatten vor dem 2.
Weltkrieg eher Versuchscharakter. Mit dem Krieg setzten Deutschland und
Großbritannien, mit dem Kriegseintritt auch die USA, erstmals den Kurzwellenrundfunk in
größerem Maßstab ein, um die Bevölkerung des Gegners zu erreichen.
Nach dem 2. Weltkrieg nahm der Kurzwellenrundfunk
einen steilen Aufstieg. Eine hauptsächlich durch die begrenzte Kapazität (siehe weiter unten)
bedingte Sättigung trat erst in den 1980er-Jahren ein. Gleichzeitig sorgten die
Verbreitung des UKW-Rundfunks und die wachsende Konkurrenz des Fernsehens dafür,
dass speziell die Ausstrahlung von Inlandsprogrammen aus Kurzwelle stark
abzunehmen begann. Die Ausstrahlung von Auslandsprogrammen auf Kurzwellen nahm
weltweit betrachtet aber weiter - wenn auch langsamer - zu, jedoch vornehmlich
bedingt durch die Inbetriebnahme neuer Sendeanlagen. |
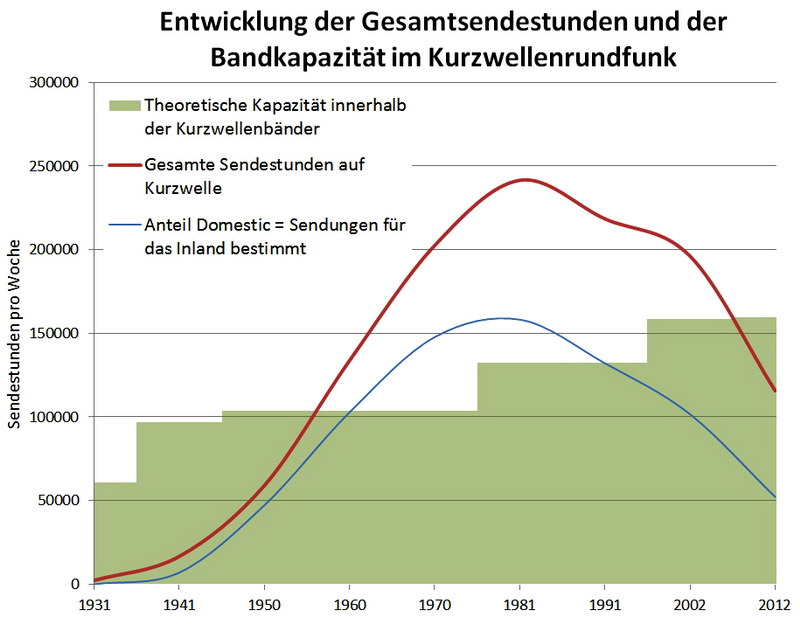 |
|
In den 1950er-Jahren begann der Bedarf an
Kurzwellenausstrahlungen die zur Verfügung stehende Kapazität zu übertreffen. Da
damals auch zahlreiche andere Kommunikationsdienste die Kurzwelle benötigten, war eine
Ausweitung der Kapazität durch Zuweisung zusätzlicher Rundfunkbänder nicht
möglich. Eine Mehrfachnutzung von Frequenzen war notwendig, führte jedoch durch
die stetig steigende Leistung der Sender und mangelnde internationale
Koordination zu vielen gegenseitigen Störungen. Speziell in Europa, wo sich rund
die Hälfte
des internationalen Kurzwellenrundfunks abspielte, führte dies in den 1970er-
und 1980er-Jahren zu unerträglichen Zuständen, welche noch dadurch verschärft
wurden, dass die osteuropäischen Länder massiv Störsender einsetzten, um
Sendungen aus dem Westen unhörbar zu machen. Im 31 m-Band z.B. waren zeitweise
mehr als die Hälfte der Frequenzen mit den Geräuschen der Störsender zugedeckt
und für den Rundfunkempfang unbrauchbar. |
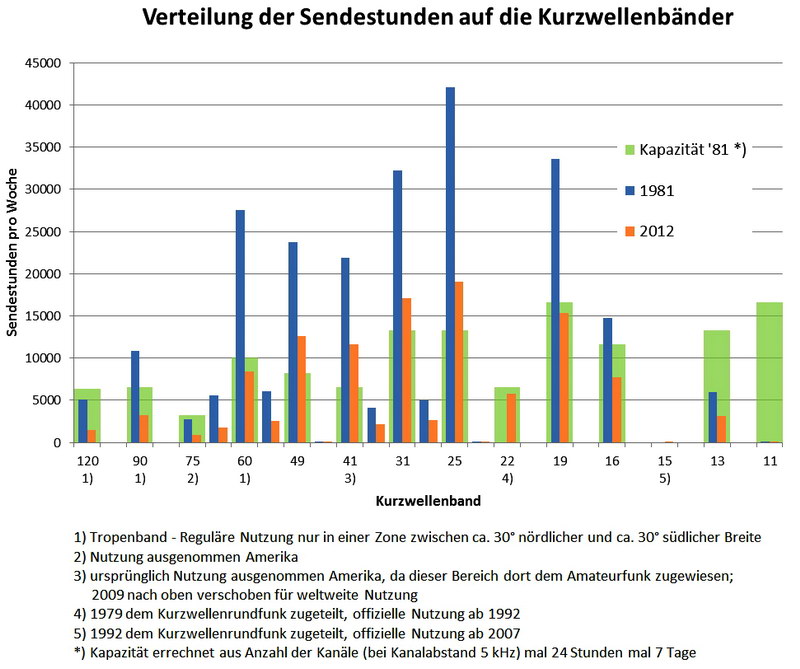 |
|
Das Problem der ohnehin begrenzten Kapazität der
Kurzwellenbänder wurde dadurch weiter verschärft, dass der Bereich der mittleren
Wellenlängen von 49 bis 19 m die
besten Nutzungsmöglichkeiten bot, sodass sich dort die Nutzer - nicht nur des
Rundfunks - drängten und zu einer Mehrfachbelegung der Frequenzen zwang. In
diesem Bereich wurde überdies häufig auf Frequenzen außerhalb der Rundfunkbänder ausgewichen, womit andere Funddienste erheblich gestört wurden.
Die oberen Kurzwellenbänder (16 bis 11 m) wurden
seit jeher viel weniger genutzt, da sie wegen der ständigen Änderungen der
Ausbreitungsbedingungen die meiste Zeit des Tages bzw. Jahres nicht zur
Verfügung stehen. Die unteren Bänder (120 bis 60 m) waren mit Ausnahme des 75 m-Bandes
nur in der tropischen Zone dem Rundfunk zugewiesen und wurden dort vornehmlich
zur regionalen Rundfunkverbreitung benützt. Wegen der meist geringen
Sendeleistung und ungerichteter Abstrahlung bereitete die Mehrfachbelegung z.B.
im 60 m-Band außer in Südamerika, wo sich bis zu 5 Stationen eine Frequenz
teilen mussten, kaum Probleme. Auch hier wichen viele Stationen auf Frequenzen
außerhalb des überbelegten 60 m-Bandes aus. |
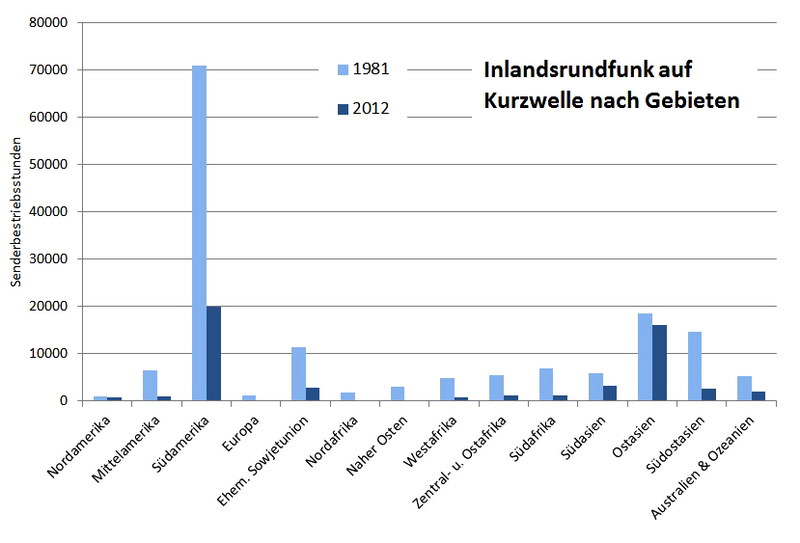 |
|
Speziell in Südamerika war es bis in die
1990er-Jahre bei vielen Radiostationen üblich, einen
Kurzwellensender parallel zur Mittelwellenausstrahlung zu benützen, um so die
Reichweite bis in die weiten wenig erschlossenen Gebiete zu erhöhen. Dies ergab 1981 eine enorme Summe von Kurzwellensendungen
in Südamerika (rund 45% des weltweiten regionalen Rundfunks auf Kurzwelle). Mit der Erschließung bislang wenig bewohnter Gebiete und der Entstehung zahlreicher Lokalsender auf UKW
dort wurden diese
Kurzwellensendungen immer weniger gehört, was zu einem starken Rückgang führte.
Eine ähnliche Entwicklung gab es Südostasien (speziell Indonesien) und Afrika, wobei
hier die Anzahl der Stationen nie groß war, da es in den meisten Staaten
Afrikas bis vor wenigen Jahren nur Staatsrundfunk gab. Gegenwärtig (2012) spielt
der Kurzwellenrundfunk in der Versorgung des eigenen Landes nur mehr in Indien und
einigen Ländern Ostasiens eine bedeutende Rolle. |
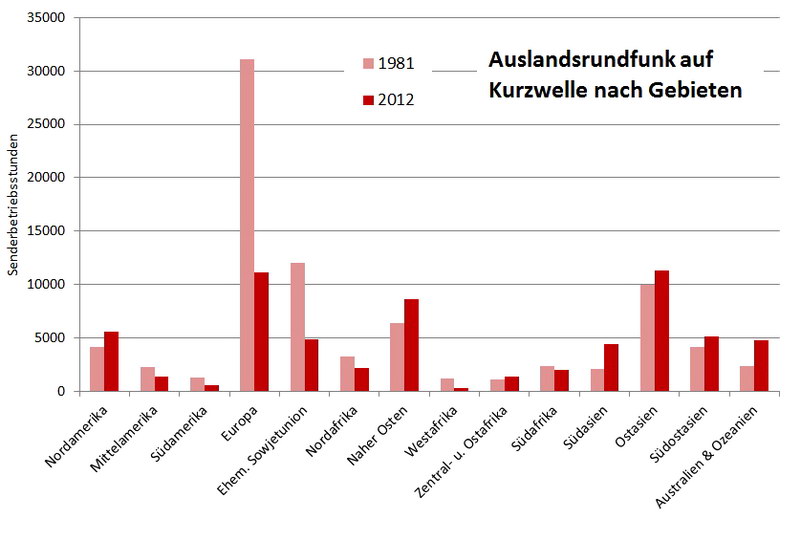 |
|
Europa war bis 1989 Hauptschauplatz einer
"Propagandaschlacht" als Teil des Kalten Krieges zwischen dem westlichen und dem
kommunistischen Machtblock. Dies bewirkte mit rund 37% der weltweiten
Sendestunden eine Dominanz Europas (mit UdSSR sogar 50%) im internationalen
Kurzwellenrundfunk. Die Zunahme in Nordamerika ist ausschließlich den in den
letzten 30 Jahren entstandenen kommerziellen
religiösen Kurzwellenstationen zu verdanken, während die "Voice of America" und
"Radio Canada International" ihre Kurzwellensendungen aus dem Mutterland
inzwischen weitgehend einstellten. Die Zunahme der Kurzwellensendungen in Asien ist
wiederum nicht so sehr einer Ausweitung der Programme als vielmehr
auf den Bau neuer Sendeanlagen zurückzuführen. |
| |
| letzte
Änderung: 12.04.2012 |